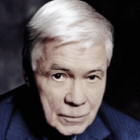|
Dietrich Fischer-Dieskau
* 28. Mai 1925 in Berlin

† 18. Mai 2012 in Berg

ABCD
Deutscher Sänger der Stimmlage
Bariton, Dirigent, Maler, Musikschriftsteller und Rezitator.
In seiner Familie hatte Musik eine große Tradition, schon Bach widmete 1742 seinem Vorfahren, dem kurfürstlich-sächsischen Kammerherrn Carl Heinrich von
Dieskau
 , die Bauernkantate BWV
212 , die Bauernkantate BWV
212  . Sein Großvater war der Pfarrer und Hymnologe Albert
Fischer . Sein Großvater war der Pfarrer und Hymnologe Albert
Fischer
 . Die Eltern, der Vater Altphilologe, die Mutter Lehrerin, förderten das Talent des Sohnes, indem sie ihm bereits als 16-Jährigem eine Gesangsausbildung an der Berliner
Musikakademie ermöglichten. . Die Eltern, der Vater Altphilologe, die Mutter Lehrerin, förderten das Talent des Sohnes, indem sie ihm bereits als 16-Jährigem eine Gesangsausbildung an der Berliner
Musikakademie ermöglichten.
Fischer-Dieskau wurde zur Wehrmacht eingezogen und geriet in Italien in amerikanische Kriegsgefangenschaft, während der er seine Gesangsstudien autodidaktisch weiter betrieb. Seine ersten Konzerte gab er im amerikanischen Gefangenenlager in Italien. Nach der Heimkehr aus der Gefangenschaft debütierte er 1947 im Deutschen Requiem von Brahms bei einer Aufführung in Badenweiler, nachdem der Baritonsolist wegen einer Erkrankung nicht auftreten
konnte.
Fischer-Dieskaus eigentliche Karriere begann dann im Januar 1948, als er erstmals Schuberts Winterreise
 für den RIAS
für den RIAS
 sang. Im selben Jahr wurde er an die Städtische Oper Berlin verpflichtet. 1949 fand die erste Schallplattenaufnahme
statt. Im gleichen Jahr gastierte er auf den Opernbühnen in München und Wien. Weitere Stationen: 1951 die Lieder eines fahrenden Gesellen von Gustav Mahler bei den Salzburger Festspielen unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler. Im selben Jahr hatte Fischer-Dieskau sein Festivaldebüt in Edinburgh mit den Brahms-Liedern. 1952 war er zum ersten Mal in den USA auf Tournee, 1954 hatte er bei den Bayreuther Festspielen sein Debüt als Wolfram im Tannhäuser.
Fischer-Dieskaus langjähriger Liedbegleiter am Klavier war vor allem Gerald
Moore
sang. Im selben Jahr wurde er an die Städtische Oper Berlin verpflichtet. 1949 fand die erste Schallplattenaufnahme
statt. Im gleichen Jahr gastierte er auf den Opernbühnen in München und Wien. Weitere Stationen: 1951 die Lieder eines fahrenden Gesellen von Gustav Mahler bei den Salzburger Festspielen unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler. Im selben Jahr hatte Fischer-Dieskau sein Festivaldebüt in Edinburgh mit den Brahms-Liedern. 1952 war er zum ersten Mal in den USA auf Tournee, 1954 hatte er bei den Bayreuther Festspielen sein Debüt als Wolfram im Tannhäuser.
Fischer-Dieskaus langjähriger Liedbegleiter am Klavier war vor allem Gerald
Moore
 , mit dem er mehrmals Schuberts Liederzyklus Winterreise einspielte. , mit dem er mehrmals Schuberts Liederzyklus Winterreise einspielte.
Seine wesentlichen Stationen waren danach Auftritte an der Carnegie Hall in New York, der Deutschen Oper Berlin, der Wiener Staatsoper, der Bayerischen Staatsoper in München und am Royal Opera House in London. Sein Repertoire umfasste etwa dreitausend Lieder von etwa hundert verschiedenen Komponisten.
Fischer-Dieskau war viermal verheiratet: 1965 bis 1967 mit der Schauspielerin Ruth
Leuwerik
 ,
seit 1977 mit der Sängerin Júlia Várady ,
seit 1977 mit der Sängerin Júlia Várady  . .
Seit 1983 war Fischer-Dieskau Professor an der Hochschule der Künste in Berlin, seit 1991 Mitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg. Am 31. Dezember 1992 beendete er in München seine aktive Karriere als Sänger.
BC
Weitere Infos:






|
|
Zitat: „Ich habe umsonst gelebt”
Interviewer: Herr Fischer-Dieskau, was hat sich in den letzten Jahren in der Oper verändert?
Fischer-Dieskau: Ich glaube, dass wir noch immer eine Menge guter Stimmen haben. Aber ich befürchte, dass sich die Einstellung zur Oper und zur Kunst im Allgemeinen geändert hat. Ich frage mich zum Beispiel, warum so viele junge Sänger kein Legato mehr singen können – das ist eigentlich die Voraussetzung zum Singen. Vielleicht liegt all das an einem Mangel an Selbstkritik, der unter jungen Sängern sehr ausgeprägt ist. Ich sehe das an meinen eigenen Studenten immer wieder.
Will man heute Star werden statt Sänger?
Auf jeden Fall wird es schwerer, Sänger zu werden, denn meistens lernt man inzwischen, wie laute Töne abgesondert werden und das am besten nach dem Motto: einer nach dem anderen. Das ist natürlich keine Methode, um eine vernünftige Phrase zu artikulieren, geschweige denn, um ein guter Sänger zu werden.
Aber wie kann das passieren, Sie selbst sind doch Dozent …
Es ist ja nicht einmal die Faulheit, denn die Sänger sind sehr fleißig, oft wird sogar sehr pingelig gearbeitet, aber leider nicht in die richtige Richtung. Wir können letztlich nur Anstöße geben. Und die werden leider schnell wieder vergessen, weil von Außen so viel Druck aufgebaut wird. Es tut mir leid, aber ich bin da gar nicht optimistisch.
Was für Druck steht denn auf der anderen Seite?
Da stehen inzwischen ja Heere von Managern hinter den Sängern, die sich einmischen und ein Bild schaffen wollen, das nichts mit den Stimmen zu tun hat. Ich selbst habe nie einen Manager gehabt. Ich halte das für unnütz. Außerdem haben viele Dirigenten kaum noch Ahnung von dem, was sie so treiben und davon, wie etwas gemacht werden sollte.
Ich sitze in der Jury des “Competizione dell´ Opera” in Dresden. Dort zeigt sich, dass Sänger aus Russland und Südamerika sehr gut sind, und dass Asiaten sogar Sänger-Legenden wie Sie imitieren.
Ja, sie imitieren, aber oft fehlt ihnen die Durchdringung der Musik. Es ist ein großes Problem, dass immer weniger Sänger Ahnung von der Sprache haben, in der sie singen – das aber ist die Grundvoraussetzung zur Durchdringung einer Partitur. In vielen anderen Ländern gibt es tatsächlich auch noch lebhafte Gesangsschulen, aber die Tongebung, die dort gelehrt wird, ist für unser Repertoire oft kaum zu gebrauchen.
Was schlagen Sie als Lösung vor?
Vielleicht sollte man sich mehr mit den alten Stimmen auseinandersetzen. Ich sehe, dass kaum noch jemand sich meine Aufnahmen anhört. Die kommen her und wissen einfach gar nichts. Ich finde es erschreckend, dass junge Leute Sänger werden wollen, ohne sich mit den alten Stimmen auseinander gesetzt zu haben. Manchmal sage ich mir, dass ich umsonst gelebt habe, dass es aus ist – vorbei.
Singen erfordert also die Auseinandersetzung mit der Tradition?
Man muss doch herausfinden, welche Sänger in ihrem Tun heute noch zeitgemäß sein können, seinen eigenen Geschmack bilden. Aber es gibt so viele wunderschöne Platten – warum nur werden die nicht mehr gehört? Schließlich ist es doch so: Nur wer Musik zu hören versteht, darf sich erdreisten, Musik zu machen.
Auf den Opernbühnen hat inzwischen das Regietheater Einzug gehalten – was sagen Sie dazu?
Ich halte es für ein Manko, dass die Regisseure sich andauernd erdreisten, den Zeitrahmen der Handlung zu verschieben. Es scheint so zu sein, dass dieses eine Grundvoraussetzung geworden ist, um als Regisseur zu bestehen. Viele Regisseure scheinen Angst zu haben, altmodisch zu wirken. Sie erkennen nicht, dass die Voraussetzung für eine richtige Wiedergabe im historischen Teil der Oper liegt. Wenn sich die Sänger auf der Bühne in der richtigen Atmosphäre befinden, ein bisschen von der Luft schnappen, die zur Entstehungszeit der Werke herrschte, ist es viel leichter, den Geist der Opern zu erfassen.
Sie hören sich sehr pessimistisch an.
Das bin ich leider auch, weil ich beobachte, dass sich die Opernhäuser mit der Aktualisierung selbst einen Strick um den Hals legen. Sie stellen die Stücke nicht mehr so dar, wie sie gemeint sind. Es herrscht das Primat der Originalität, nicht der historischen Verantwortung.
Wie sind Sie selbst an eine neue Opernproduktion herangegangen?
Ich habe mich schon lange vor den Bühnenproben mit den Stücken beschäftigt, bis sie mir in Leib und Seele übergegangen waren. Heute ist da viel Egoismus und Selbstinszenierung im Spiel. Man muss die Kritikfähigkeit am eigenen Organ ausbilden und sich bewusst darüber werden, welche Farben man zur Verfügung hat und welche man einsetzen kann, um eine Rolle zu gestalten. Es geht erst einmal um den Urzustand der von sich gegebenen Töne. Jener Töne, die entstehen, ohne dass man das Gehirn einschaltet. Sie sind die Basis des Singens.
Haben Sie in Proben neue Blicke auf Rollen bekommen?
Nur von der darstellerischen, nicht von der musikalischen Seite. Wenn Karl Böhm gesagt hat, “Wenn Sie da weggehen, kann ich Sie nicht sehen”, dann war das o.k. Aber in der Regel habe ich bei ihm die Arbeit mit dem Orchester mitbekommen. Die war hochinteressant. Böhm traute sich allerdings nicht, den Sängern viel zu sagen.
Mit welchen Regisseuren haben Sie gern zusammen gearbeitet?
Mit Regisseuren, die das Stück auswendig konnten, die jedes Wort und jede Note kannten. Das finden Sie ja heute gar nicht mehr. Rudolf Hartmann hat in München etwas altbacken inszeniert, aber er war ein überlegener Verwalter der Oper. Ponnelle, Rennert, das waren Persönlichkeiten, die es heute gar nicht mehr gibt. Da habe ich auch manchmal von der Bühne gerufen: “Wozu?” – aber es kamen immer Antworten. Heute sind Regisseure oft Diktatoren, die nichts auf sich zukommen lassen, sondern alles so haben wollen, wie sie es sich am Reißbrett ausgedacht haben.
Gehen Sie selbst noch in die Oper?
Selten. Ich ärgere mich meist so sehr, dass ich in der Pause verschwinde. Mir gelingt es nicht mehr, das, was ich sehe und höre, mit dem Stück, das gegeben wird, in Verbindung zu bringen. In Bayreuth ist von der alten Gesangsschule nichts übrig geblieben. Und es fängt ja schon damit an, dass viele Dirigenten nicht mehr den Mut haben, sich in der Stellprobe zu beschweren, dass irgendeine Position auf der Bühne die klangliche Qualität beeinträchtigt. Dann fehlt da am Ende natürlich etwas.
|