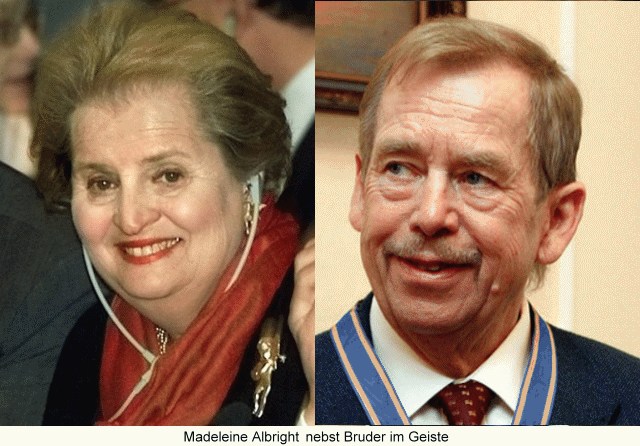|
Raubkunst in der Wohnung der
ehemaligen US-Außenministerin
Der frühere Präsident der Tschechischen Republik, Vaclav
Havel  , wurde
vor sieben Jahren, nämlich am
23. September 2006 in Passau, gemeinsam mit der ehemaligen US-Außenministerin Madeleine Albright , wurde
vor sieben Jahren, nämlich am
23. September 2006 in Passau, gemeinsam mit der ehemaligen US-Außenministerin Madeleine Albright
 mit dem 'Menschen-in-Europa Award'
mit dem 'Menschen-in-Europa Award'  der Verlagsgruppe „Passauer Neue Presse“
der Verlagsgruppe „Passauer Neue Presse“  ausgezeichnet. Zwei wahrhaft würdige Menschen in Europa!!!
ausgezeichnet. Zwei wahrhaft würdige Menschen in Europa!!!
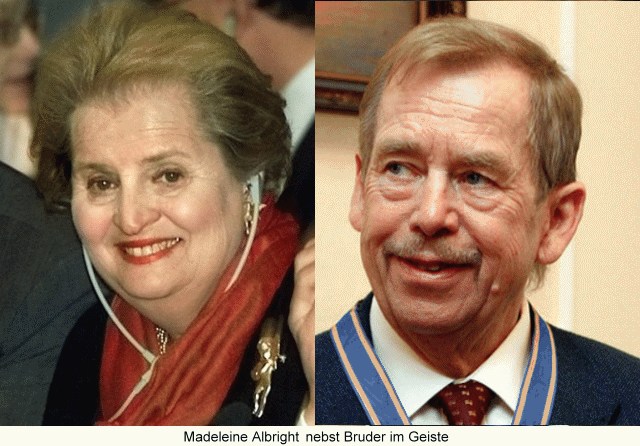
Dazu erinnerte der Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich Gerhard
Zeihsel, dass schon in den neunziger Jahren Grauslichkeiten über die in Passau
geehrte US-Außenministerin ans Tageslicht kamen. Die damalige
US-Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika Madeleine Albright, sah sich mit
dem Vorwurf des Raubkunst-Besitzes konfrontiert. Ihr Bruder im Geiste Vaclav
Havel, der sich nie von den kriminellen Benesch-Dekreten lossagte, aber sich
seinen eigenen beschlagnahmten Besitz selbst zurückerstattete, bildete das
passende Gegenstück zu Albright bei der Passauer Preisverleihung.
Vorgeschichte: Zu den zahlreichen deutschen Familien, die um die Jahrhundertwende in dem damals zur k. u. k. Monarchie gehörenden Prag wirtschaftlich erfolgreich waren, gehörten die Nebrichs. Die aus Hessen stammende Industriellen-Dynastie hatte in Prag mehrere Maschinenfabriken gegründet und erfolgreich geleitet und war damit zu Ansehen und einem beträchtlichen Vermögen gelangt.
Die Familie lebte in einer prächtigen Villa am Hradschinplatz 11, die auch Sitz der Sammlung wertvoller Gemälde aus verschiedenen Epochen europäischer Kunst war, welche die Familie im Laufe vieler Jahre erworben hatte. Das "Triptychon" von Gerard David allein hat heute einen Wert von 1,5 Millionen Mark.
1932 verstarb das Familienoberhaupt Karl Nebrich. Seine Angehörigen lebten weiter in der Villa am Hradschinplatz und konnten dank des hinterlassenen Vermögens einen standesgemäßen Lebensstandard aufrechterhalten. Dann kam das Kriegsende. Die Rote Armee eroberte Prag. Die tschechischen
Verbrecher übernahmen die Macht und verwirklichten, was sie seit vielen Jahren geplant hatten: Alle Deutschen wurden aus der Tschechoslowakei
vertrieben, soweit man sie nicht umgebracht hatte.
In den Benesch-Dekreten vom 10. August 1945, jenen allem Völkerrecht hohnsprechenden, heute noch geltenden Gesetzen, las man, dass Wertpapiere, Wert- und Kunstgegenstände der Deutschen entschädigungslos enteignet werden. 1946 bestimmte das Restitutionsgesetz der CSR, dass enteigneter deutscher Besitz an "national zuverlässige Personen" auszuhändigen sei.
Einer dieser im Sinne "zuverlässigen" Personen war der jüdische Emigrant Josef Körbl
 , Beamter im tschechischen Außenministerium. Er war zurückgekehrt und meinte
nun, ein moralisches Recht auf seinen Anteil an der Kriegsbeute zu haben. , Beamter im tschechischen Außenministerium. Er war zurückgekehrt und meinte
nun, ein moralisches Recht auf seinen Anteil an der Kriegsbeute zu haben.
So eignete sich Körbl das Renaissance-Mobiliar, die echten Teppiche und das Familiensilber der Nebrichs sowie dreißig Gemälde aus der Privatsammlung der Familie an. Er stieg in der Hierarchie des tschechischen Unrechtsstaates empor und brachte es bis zum tschechischen Botschafter in Jugoslawien. 1948 wanderte er unter Mitnahme seines gesamten ihm vom tschechischen Staat überlassenen geraubten deutschen Vermögens in die USA aus und änderte seinen
Namen in Korbel.
Die beiden Töchter des Fabrikanten Nebrich wohnten als Vertriebene in Österreich und suchten nach dem ihnen völkerrechtswidrig weggenommenen Privatvermögen – jahrzehntelang ohne Erfolg. Da stießen sie 1996 auf eine Spur: Die damalige Uno-Botschafterin der USA, Madeleine Albright, besuchte Prag und erzählte den Medien von ihrer Kindheit in der ehemals deutschen Villa am Hradschinplatz 11. Die
spätere US-Außenministerin trug den Mädchennamen Korbel; wie sich herausstellte, war das die amerikanisierte Form des Namens des ehemaligen tschechischen Botschafters Körbl.
Die Familien Nebrich und Körbl hatten 1945 nacheinander dieselbe Wohnung im Haus Nummer 11 am Prager Hradschin bewohnt. An die dort zusammengetragenen Schätze ihrer Eltern erinnerte sich die Kunsthistorikerin Doris Renner,
eine der beiden Töchter von Karl Nebrich, noch genau: Ein Triptychon der Anbetung Christi durch die Heiligen Drei Könige gehörte dazu, gemalt vom Niederländer Gerard David (1460 bis 1523); eine barocke Madonnenskulptur, Gemälde der Niederländer Ludolf Backhuysen und Hendrik van
Steenwijck, dazu kostbare Teppiche, Renaissancemöbel, Tafelsilber und etwa 30 weitere Bilder. Ein Album, das den gesamten Besitz auch fotografisch dokumentierte, verschwand 1945 allerdings ebenso wie die Kunstsammlung selbst.
Die Kunst- und Wertsachen hatte Doris Renner angesichts des nahen Kriegsendes 1944 ihrer Schwester Hilga übergeben, die ebenfalls in Prag lebte, aber durch Heirat Schweizer Staatsbürgerin war. Dass die Nebrich-Wohnung 1945 aufgrund eines Dekrets der kommunistischen
Benesch-Regierung als deutsches Eigentum beschlagnahmt worden war, erfuhr die Familie in Österreich - ebenso, dass der neue Besitzer, der Diplomat Josef
Körbl, bei der Schwester von Doris Renner die Herausgabe der Bilder und Skulpturen erzwungen hatte. "Er drohte mit Anzeige und Verhaftung", erinnert sich Doris Renner. "Dabei war kein Mitglied unserer Familie je Mitglied einer Nazi-Organisation."
Nach dem Krieg forschte Doris Renner
in Prag und den USA nach dem Verbleib der Familiensammlung - erfolglos. Bis der
oben erwähnte Zufall zu Hilfe kam: Doris Renner erfuhr von einer Prager Freundin, dass Madeleine Albright bei einem Prag-Besuch im Dezember 1996 auch in das Haus Nummer 11 am Hradschin gekommen war und
von ihrer glücklichen Kindheit erzählt hatte. Beantwortet
war inzwischen auch die Frage, ob die Familie Albright-Korbel noch die von den Tschechen geraubten Gemälde
besaß. Der Journalist Michael Dobbs entdeckte tatsächlich einige der Bilder aus der Sammlung der Familie Nebrich in
den Wohnungen von Albright und ihres Bruders John J. Korbel. 1997 erhielt die damalige amerikanische Außenministerin Madeleine Albright
einen Brief, der mehr als deutlich war: "Ihre Familie", so schrieb Doris Renner, in Österreich lebende Tochter der Kunstsammler-Witwe Elfriede
Nebrich, "hat widerrechtlich Kunstwerke in ihrem Besitz, die uns gehören."
Zunächst reagierte die Politikerin nicht.
Als die rechtmäßigen Erben des Vermögens nachdrücklich wurden, wich sie aus: sie habe keine Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, doch werde ihr Bruder John sich des Problems annehmen. Der berief sich zunächst auf das Benesch-Dekret und erklärte später, die Kunstwerke seien ein Geschenk von Jan
Masaryk  , damals Außenminister der Tschechoslowakei, der mit Josef
Körbl befreundet gewesen sei.
"Masaryk war ein Freund unserer Familie", hielt Doris Renner dem entgegen, "der nie unser Eigentum verschenkt hätte." , damals Außenminister der Tschechoslowakei, der mit Josef
Körbl befreundet gewesen sei.
"Masaryk war ein Freund unserer Familie", hielt Doris Renner dem entgegen, "der nie unser Eigentum verschenkt hätte."
John Korbel lehnte weiter die Rückgabe ab und schaltete dann einen amerikanischen Anwalt ein.
Dieser schrieb an den mit der Interessenwahrnehmung der Familie Nebrich beauftragten Philipp Harmer,
den Enkel der anderen Tochter Karl Nebrichs: "Es besteht kein Grund zu der Annahme, dass irgendein Kunstwerk unrechtmäßig in den Besitz des früheren Botschafters Korbel gelangt ist." Und weiter: "Ihr
(Nebrichs) Eigentum fiel unter die sogenannten Benesch-Dekrete, welche die Enteignung von deutschem Eigentum vorsahen." Damit
berief sich der Anwalt der amerikanischen Außenministerin auf Gesetze, die von Anfang an völkerrechtswidrig waren.
Die rechtmäßigen Erben in Österreich wollten nicht aufgeben und
beabsichtigten, die Familien Albright und Korbel zu verklagen. Immerhin hatte
ein Jahr zuvor das US-Repräsentantenhaus in einer Resolution alle ehemaligen kommunistischen Staaten aufgefordert, Enteignungen rückgängig zu machen und die entsprechenden Gesetze, also auch die Benesch-Dekrete, auf die sich Madeleine Albright
berief, aufzuheben.
Im Namen der beiden Töchter
seines Urgroßvaters Karl Nebrich verklagte der Österreicher Philipp Harmer die
Korbel-Albright-Familie wegen des nicht rechtmäßigen Besitzes der Kunstsammlung.
Anstatt die Sammlung freiwillig herauszugeben, ließen sich die Korbel-Albrights von den tschechischen Behörden eine Bestätigung ausstellen, dass sie die Bilder aufgrund der Benesch-Dekrete zu Recht besitzen würden.
Elfriede Nebrich, die Witwe Karl Nebrichs, so argumentiert das Ministerium, sei kein Opfer des NS-Regimes gewesen. "In meinen Augen", teilte der Familienanwalt Jaffe deshalb ihren Erben per Fax mit, "ist diese Angelegenheit beendet."
"Dabei wird völlig ignoriert", sagte Philipp Harmer, "dass die Herausgabe der Bilder bei einer Schweizer Staatsbürgerin erzwungen wurde, auf die die
Benesch-Dekrete gar nicht angewendet werden durften." Wegen des Risikos und der
hohen Kosten einer Klage vor einem US-Gericht verfolgte Harmer die Angelegenheit
schließlich nicht weiter. Die Familien Albright-Korbel können sich also weiter
an ihrer von den Tschechen geraubten und an sie als Hehlerware weitergereichten
Raubkunst erfreuen.
|